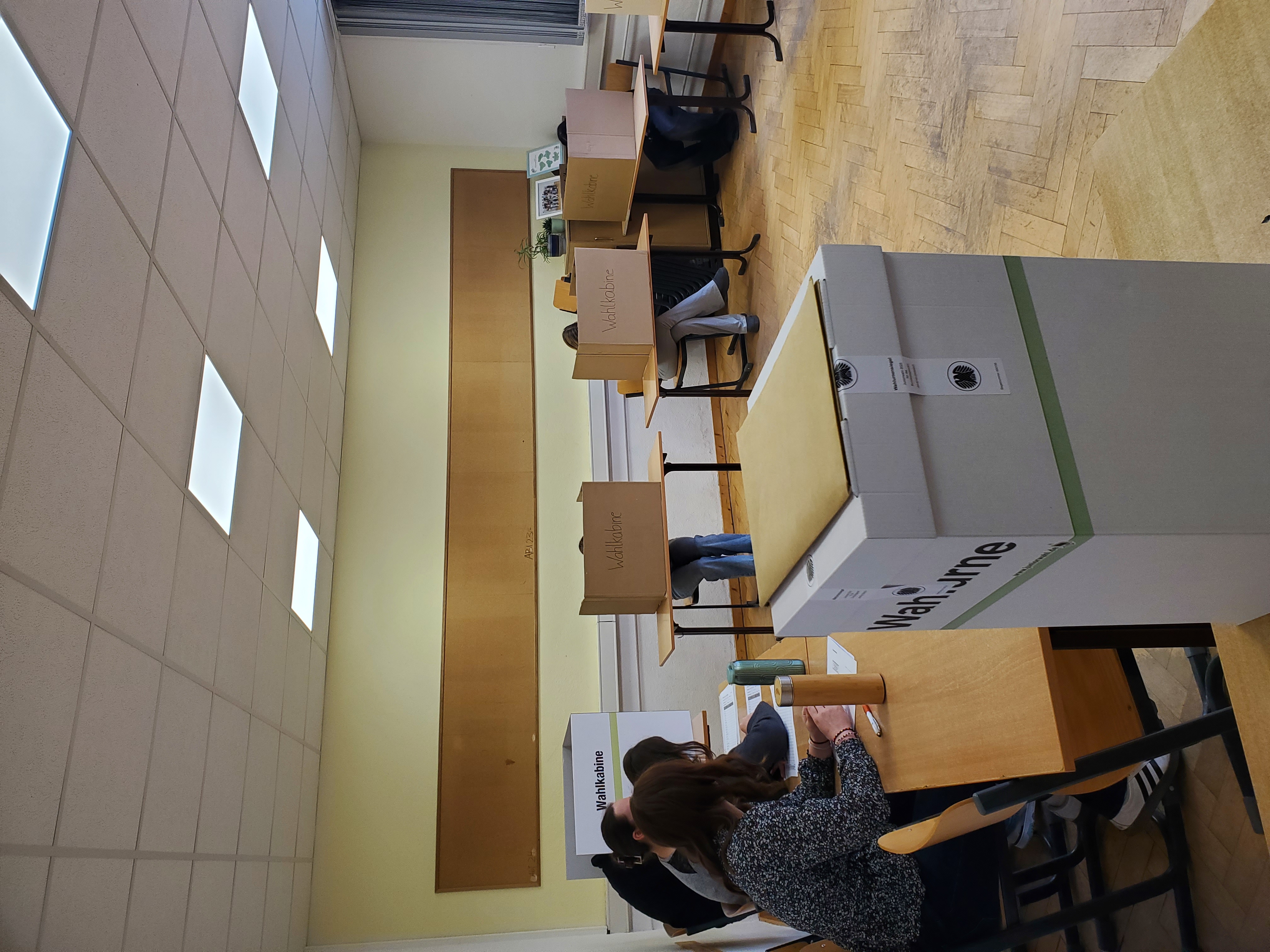Anschließend wurden die Frauen in Zellen gebracht, in denen vier bis sechs Personen untergebracht waren. Die Zellen waren mit Doppelstockbetten ausgestattet und äußerst beengt. Anfangs (bis in die 60er) gab es keine Toiletten (mit fließendem Wasser), sondern nur Metallkübel. Waschbecken existierten ebenfalls nicht; stattdessen mussten sich die Frauen kleine Becken mit Wasser teilen. Schon beim Entleeren und Reinigen dieser Kübel zeigte sich ein Hierarchiesystem: Mörderinnen standen ganz oben, politische Gefangene, wie Frau Regina Labahn, ganz unten. Letztere mussten die ‘Drecksarbeit’ übernehmen und diese Kübel ausleeren. Daher hofften sie oft auf Arbeitsaufträge, in der Hoffnung, in größere Zellen verlegt zu werden – möglichst ohne Mörderinnen.
Die politischen Gefangenen litten nicht nur unter den anderen Insassinnen, sondern auch unter der Behandlung durch die Schließerinnen und Erzieherinnen. Sie wurden häufig nur mit ihrer Gefängnisnummer angesprochen – ein weiteres Mittel der Entmenschlichung. Selbst einfache Gesten wie Händedrücken oder eine Umarmung konnten eine Arreststrafe nach sich ziehen. Diese gab es in drei Stufen: leichter, mittlerer und schwerer Arrest. Beim ,,leichten Arrest” wurde eine einwöchige Strafe verhängt. Die Insassin wurde in eine schmale Zelle mit einer Holzpritsche und einer Decke gesperrt. Diese Gegenstände wurden tagsüber entfernt, sodass keine Möglichkeit bestand, sich auszuruhen. Solche Strafen wurden meist bei einmaliger Arbeitsverweigerung verhängt. Beim ,,mittleren Arrest” wurde die Insassin in eine sogenannte ,,Tigerzelle” gesperrt. Hier wurde häufig sogar der Toilettenkübel vorenthalten. Wenn die Gefangene dann ihre Notdurft in eine Ecke verrichtete, wurde sofort mit eiskaltem Wasser aus einem Schlauch abgespritzt und musste die Zelle selbst reinigen – eine demütigende und sadistische Bestrafung. Die schwerste Form war der sogenannte ,,strenge Arrest”. Die Frauen wurden für ein bis drei Wochen in völliger Dunkelheit eingesperrt, nur in Zuchthauskleidung. Wenn sie Glück hatten, erhielten sie eine Decke und einen Kübel. Die Verpflegung war minimal: ein Marmeladenbrot zum Frühstück, Suppe mittags, Brot mit Wurst abends. Das Zeitgefühl ging bereits nach wenigen Stunden verloren. Nach ihrer Entlassung – meist geschwächt und unterkühlt – mussten die Frauen meist sofort weiterarbeiten.

Unsere Führung setzte sich auf der zweiten Etage fort, in der sich Zellen für bis zu 36 Frauen befanden. Auch diese waren viel zu klein. Es gab nur wenige Waschbecken und Toiletten – viel zu wenig für die Anzahl der Frauen. Wieder spiegelte sich die Hierarchie wider: Zuerst durften Frauen, die ihre Männer getötet hatten, in den Waschraum, danach andere – politisch Gefangene zuletzt. Dies erschwerte das Einhalten des 30-Minuten- Zeitfensters nach dem Aufstehen erheblich. Einzige Ausnahme waren manche Sonntage, an denen nicht gearbeitet werden musste. Trotz der Überfüllung war es in den Zellen im Winter eiskalt. Frau Labahn berichtete: „Ich habe noch nie so sehr gehungert und gefroren.“ An den Fenstern bildeten sich teilweise Eiszapfen.
Einmal wöchentlich mussten sich die Frauen mit eiskaltem Wasser duschen. Da es keine warmen Waschmöglichkeiten gab, nutzten sie Malzkaffee zum Haarewaschen. Für Medikamente gab es nur Salben. Frauen mit Entzündungen wurden in stark brennenden Flüssigkeiten gebadet – was zu lauten Schreien führte, wie Frau Labahn berichtete. Diese Prozeduren wurden offenbar bis zum Mauerfall durchgeführt.

Im Keller des Gebäudes befanden sich die Wasserzellen. In diesen mussten Frauen in knöchel- bis wadenhohem, eiskaltem Wasser stehen – oft ein bis zwei Stunden lang. Die Holzpritschen waren tagsüber an den Wänden befestigt und unbrauchbar gemacht. Besonders hart traf es Frauen, die 1946-1949 vom sowjetischen Militärtribunal (SMT) verurteilt worden waren: Sie hatten oft weniger Kleidung und froren stärker. Diese Zellen wurden bis etwa 1959 oder 1961 von den DDR-Behörden (weiter-)verwendet.
Ein weiterer Raum, noch im Umbau, soll künftig als „Raum der Stille“ dienen – zur Erinnerung an die Leiden der Frauen. „Ein kleines Highlight für mich“, sagte Frau Labahn. Zum Schluss zeigte sie uns den Außenbereich mit Wachtürmen und Hundeausläufen. Auf die Frage, ob je jemand entkommen sei, berichtete sie von zwei Frauen, denen in den 1990er Jahren tatsächlich die Flucht bis zum Bahnhof gelungen sei.

Anschließend durften wir Frau Labahn Fragen stellen. Besonders hervorstechend, war ihre Antwort auf die Frage, ob sie während der zwei Jahre in Hoheneck Kontakt zu ihrem Mann hatte. Sie sagte, dass Briefe erlaubt waren – jedoch ohne Hinweise auf die Bedingungen im Gefängnis.
Doch welche Bedeutung hat das Frauengefängnis Hoheneck für uns heute? Bis heute fehlen viele Akten, darunter Krankenakten. Frau Labahn weiß nicht, was ihr bei Krankheiten wie Grippe gespritzt wurde, ein Geschehen, was sie bis heute traumatisierte. Auch wurden die Schließerinnen und Erzieherinnen nie zur Rechenschaft gezogen – ihre Verbrechen verjährten. Keine der betroffenen Frauen bekam je Gerechtigkeit für die Misshandlung, die ihnen wiederfuhr. Gerade deshalb ist der Erhalt solcher Gedenkstätten wie Hoheneck so wichtig – um zu erinnern, zu lernen und niemals zu vergessen. Deswegen, kann ich jedem nur empfehlen diese Orte zu ehren und zu waren.